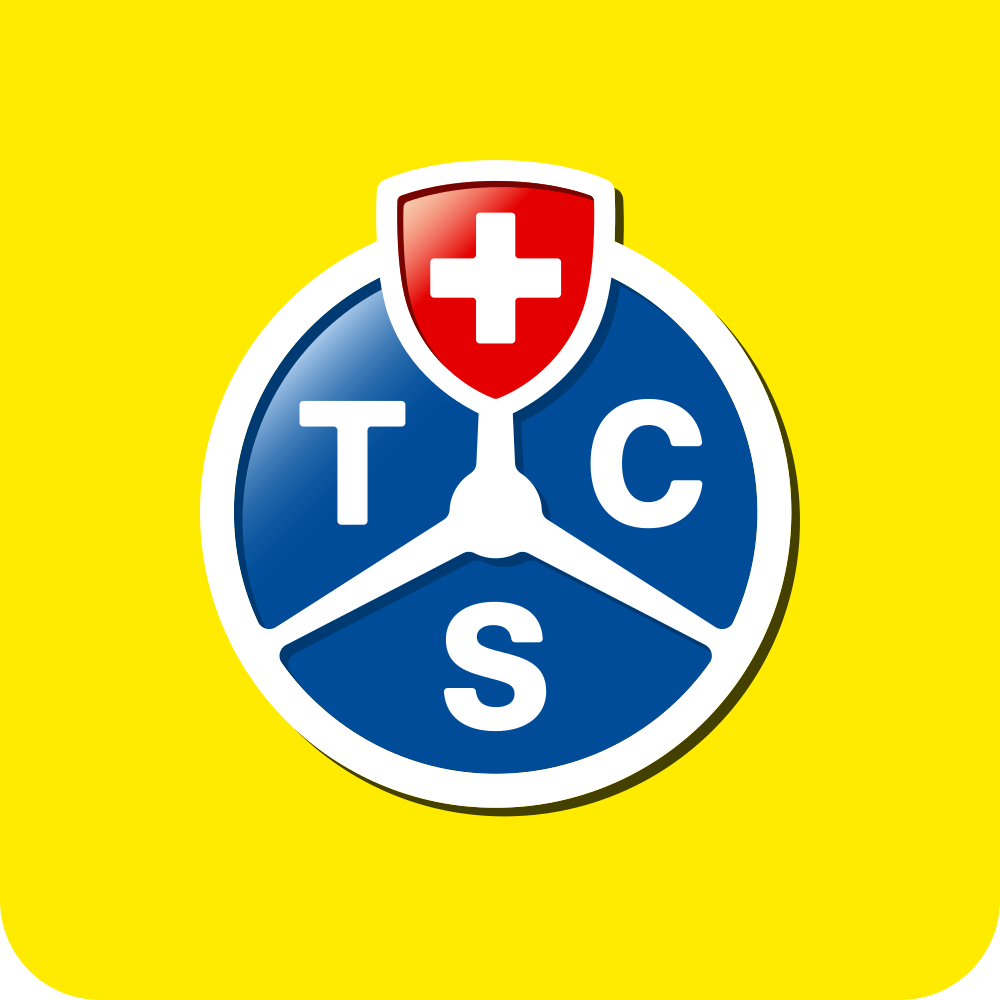Familie
Muss ich nach der Scheidung Ehegattenunterhalt bezahlen?

Grundsätzlich muss nach einer Scheidung jeder Partner für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommen.
Nur wenn es für einen Ehegatten unzumutbar ist, für seinen Unterhalt und seine Altersvorsorge selbst aufzukommen, muss ihm der andere Ehegatte einen angemessenen Beitrag leisten. Aufgrund des klaren Wortlautes des Gesetzesartikels gilt laut Bundesgericht «das Primat der Eigenversorgung und damit eine Obliegenheit zur (Wieder-) Eingliederung in den Erwerbsprozess». Damit fällt der Ehegattenunterhalt in der Regel ganz oder teilweise weg, wie das Bundesgericht in fünf am 9. März 2021 kommunizierten Entscheiden bestätigt hat.
Das Bundesgericht hat in den Entscheiden präzisiert, wann und in welchem Umfang eine Eigenversorgung nach der Scheidung zumutbar ist. Dabei hatte es unterschiedliche Konstellationen zu beurteilen. (Siehe auch: «Muss ich arbeiten gehen, obwohl mein Kind noch im Kindergarten ist?»)
Kinderloses Paar: 57-jährige Hausfrau kann sich selbst versorgen
Ein kinderloses Paar trennt sich nach 8 Jahren Ehe, die sie als Distanzbeziehung geführt haben. Zum Urteilszeitpunkt ist die Ehefrau 57 Jahre alt. Das Bundesgericht verneint die nacheheliche Unterhaltspflicht, auch wenn sich die Ehefrau während der Ehe «vollständig in die finanzielle Abhängigkeit ihres Ehemannes begeben habe». Sie sei spätestens ab Trennungszeitpunkt gehalten gewesen, «ihre Eigenversorgungskapazität voll auszuschöpfen». Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sei realistisch, beispielsweise im Pflegebereich werde auch älteres Personal gesucht. (Entscheid des Bundesgerichts vom 3. November 2020)
36-jährige Hausfrau und Mutter schuldet Barunterhalt für Kind
Ein Ehepaar trennt sich nach fünf Ehejahren, das gemeinsame 5-jährige Kind bleibt in der Obhut des Vaters. Der Vater ist voll erwerbstätig, die 36-jährige Mutter nimmt nach der Trennung ihre während der Ehe aufgegebene Erwerbstätigkeit in der Pflege mit zahlreichen Unterbrüchen wegen Arbeitslosigkeit und Krankheit wieder auf. Das Bundesgericht hält fest, dass gegenseitig kein nachehelicher Unterhalt geschuldet ist und verpflichtet die Mutter zu einem anteilsmässigen Barunterhalt für das Kind, wobei ihr nach einer Übergangsfrist eine Vollzeittätigkeit zuzumuten sei. (Entscheid des Bundesgerichts vom 11. November 2020)
50-jährige Mutter hat sich nach 17-jährigem Erwerbsunterbruch selbst zu versorgen
Ein Ehepaar mit drei gemeinsamen Kindern lässt sich nach 17 Jahren scheiden. Die nicht erwerbstätige Mutter und ausgebildete Informatikerin ist zum Trennungszeitpunkt 44 Jahre und zum Scheidungszeitpunkt 50 Jahre alt. Das Bundesgericht hält fest, dass der Verzicht des einen Partners auf die eigene Karriere dem anderen Partner den beruflichen Aufstieg ermöglichen könne. Gleichwohl müsse sich nach einer Scheidung grundsätzlich jeder Partner selbst versorgen. Dies sei im vorliegenden Fall zumutbar, da ein Berufseinstieg der Frau im Gastgewerbe, dem Detailhandel oder der Hilfspflege möglich sei. Das Bundesgericht kürzt entsprechend den nachehelichen Unterhalt auf rund die Hälfte des ursprünglich geforderten Betrags. (Entscheid des Bundesgerichts vom 2. Februar 2021)
Ein weiteres Ehepaar mit einem gemeinsamen Kind trennt sich nach 13 Jahren. Die nicht erwerbstätige Mutter ist zum Zeitpunkt der Trennung 41 Jahre alt. Das Bundesgericht erachtet eine Erwerbstätigkeit der Mutter als zumutbar und hält auch hier eine Beschäftigung im Bereich der Hilfspflege als realistisch, weswegen es den nachehelichen Unterhalt auf knapp die Hälfte des ursprünglich geforderten Betrags gekürzt hat. (Entscheid des Bundesgerichts vom 9. Februar 2021)
49 – jährige Mutter erhält aus prozessualen Gründen Ehegattenunterhalt
In einem weiteren Fall musste sich das Bundesgericht gar nicht zu der Zumutbarkeit einer Aufnahme der Erwerbstätigkeit äussern: Ein Ehepaar mit zwei gemeinsamen Kinder trennt sich nach 14 Jahren Ehe, die nicht erwerbstätige Mutter ist zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt. Das Bundesgericht geht aus prozessualen Gründen nicht auf die mögliche Eigenversorgungskapazität der Mutter ein und spricht ihr einen nachehelichen Unterhalt bis zum Erreichen des Rentenalters zu. (Entscheid des Bundesgerichts vom 2. Februar 2021)
Aktualisiert am 13. Juli 2023