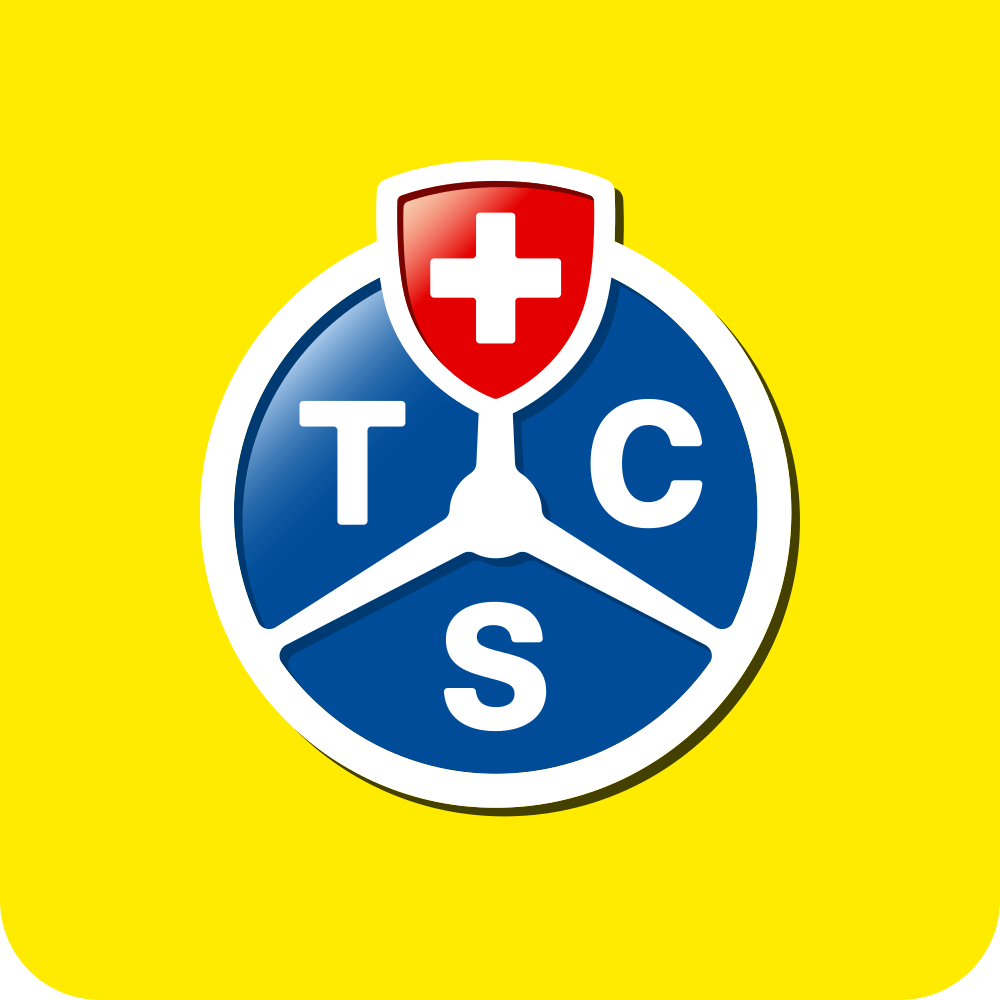Warenfälschung
Gefälschte Artikel im Internet bestellen
- «Marke» und «Design»: Was ist was?
- Gefälschte Ware: Wo ist das Problem?
- Wie erkenne ich, ob ein Online-Shop gefälschte Ware anbietet?
- Hafte ich, wenn mein minderjähriger Sohn mit meiner Kreditkarte gefälschte Ware bestellt?
- Spielt es eine Rolle, wie viel gefälschte Ware ich bestelle?
«Marke» und «Design»: Was ist was?
Eine «Marke» unterscheidet Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen. Ein «Design» ist eine eigenständige Gestaltung eines Produktes. Gemeinsam ist beiden, dass sie das geistige Eigentum schützen.
Gefälschte Ware: Wo ist das Problem?
Warenfälschungen schädigen nicht nur grosse Konzerne, sondern gefährden auch die Innovation und Kreativität von kleineren und mittleren Unternehmen. Denn geistiges Eigentum ist ein Vermögenswert: Das Unternehmen hat in der Regel viele Ressourcen in den Aufbau einer Marke oder in die Gestaltung eines Designs gesteckt. Damit sich diese Innovation und Kreativität für ein Unternehmen finanziell lohnt, kann es die Marke oder das Design eintragen lassen. Mit dem Eintrag ist das geistige Eigentum geschützt und das Unternehmen kann unter anderem gegen all jene vorgehen, welche dieses Eigentum ohne Erlaubnis kopieren.
Aufgepasst: Ein gefälschtes Produkt kann auch gefährlich sein. So kann etwa ein schlecht verarbeiteter Akku explodieren oder ein kopiertes Markenkleid kann wegen giftiger Chemikalien Gesundheitsrisiken bergen.
Wie erkenne ich, ob ein Online-Shop gefälschte Ware anbietet?
Während lange Zeit auffällige Rechtschreibfehler oder gebastelt wirkende Logos zuverlässige Hinweise auf problematische Online-Shops gaben, ist dies heute namentlich dank auf künstlicher Intelligenz basierender Software nicht mehr der Fall: Ein Onlineshop kann äusserst professionell wirken und gleichwohl gefälschte Produkte anbieten.
Fake-Shops oder Online-Shops mit gefälschter Ware sind gleichwohl erkennbar. Dabei sind folgende Punkte nach wie vor Warnsignale:
- Der Shop bietet im Vergleich zu einem offiziellen Shop oder zum normalen Verkaufspreis deutlich tiefere Preise.
(Siehe auch: «7 Antworten zum «Stopp der Hochpreisinsel Schweiz»)
- Die URL enthält Buchstabendreher oder nicht nachvollziehbare Ergänzungen.
- Die Website enthält kein Impressum, das Impressum enthält unklare Kontaktangaben oder es meldet sich niemand auf die Kontaktaufnahme.
Gewerbliche Websites sind impressumspflichtig. Das Impressum muss es dem User ermöglichen, mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen. Die Domain-Namen-Abfrage von Switch ermöglicht es zudem, herauszufinden, wo die Inhaberin des Domain-Namens den Namen registriert hat. (Siehe auch: «Gilt für die Website meines Vereins die Impressumspflicht?»)
- Ein Bewertungsprofil fehlt vollständig oder die Rezensionen sind auffällig gut oder alle im gleichen Stil verfasst.
- Die Site arbeitet mit Gütesiegeln, welche entweder gar nicht existieren oder die falsch verlinkt sind. Ein Klick auf das Siegel erlaubt, dessen Echtheit zu prüfen.
Aufgepasst: Es gibt nicht nur gefälschte Uhren, Handtaschen, Schuhe oder Medikamente. Fälschungen können alle Produkte betreffen, so gibt es etwa auch gefälschte Autoersatzteile, Haushaltgeräte oder Parfums.
Hafte ich, wenn mein minderjähriger Sohn mit meiner Kreditkarte gefälschte Ware bestellt?
Die Kreditkarteninhaberin ist gemäss den jeweiligen Vertragsbedingungen der Kreditkartenherausgeberin dafür verantwortlich, die Karte vor unbefugtem Zugriff zu schützen und Dritten nicht auszuhändigen. Hat ein minderjähriges Kind einfach Zugang zur Kreditkarte und den Authentifizierungsdaten wie dem PIN-Code oder dem temporären, auf das Mobile oder die e-Mailadresse gesendeten Sicherheitscode, haftet die Kreditkarteninhaberin für den Kauf.
Belegt die Karteninhaberin jedoch, dass sie ihre Sorgfaltspflichten erfüllt hat und teilt die gesetzliche Vertretung unmittelbar nach dem Kauf den Rücktritt mit, ist der Kauf nichtig.
Aufgepasst: Waren die Kreditkartenunternehmen lange kulant, haben viele ihre Praxis verschärft und stellen hohe Anforderungen an den Beweis der Einhaltung der Sorgfaltspflichten.
Spielt es eine Rolle, wie viel gefälschte Ware ich bestelle?
Ja. Findet das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) eine grosse Menge gefälschter Ware in einer Sendung oder in Verbindung mit dem Besteller, besteht der Verdacht auf Gewerbsmässigkeit. Hier muss die zuständige Behörde von Amtes wegen eingreifen. Dies gilt bei einer Markenrechtsverletzung ebenso wie bei einer Designrechtsverletzung.
Es gibt keine fixe Grenze, ab welcher das BAZG oder allenfalls das Gericht eine Gewerbsmässigkeit annehmen. Als eine Faustregel gilt, dass beispielsweise 10 T-Shirts oder eine Uhr unter den Privatgebrauch fallen.