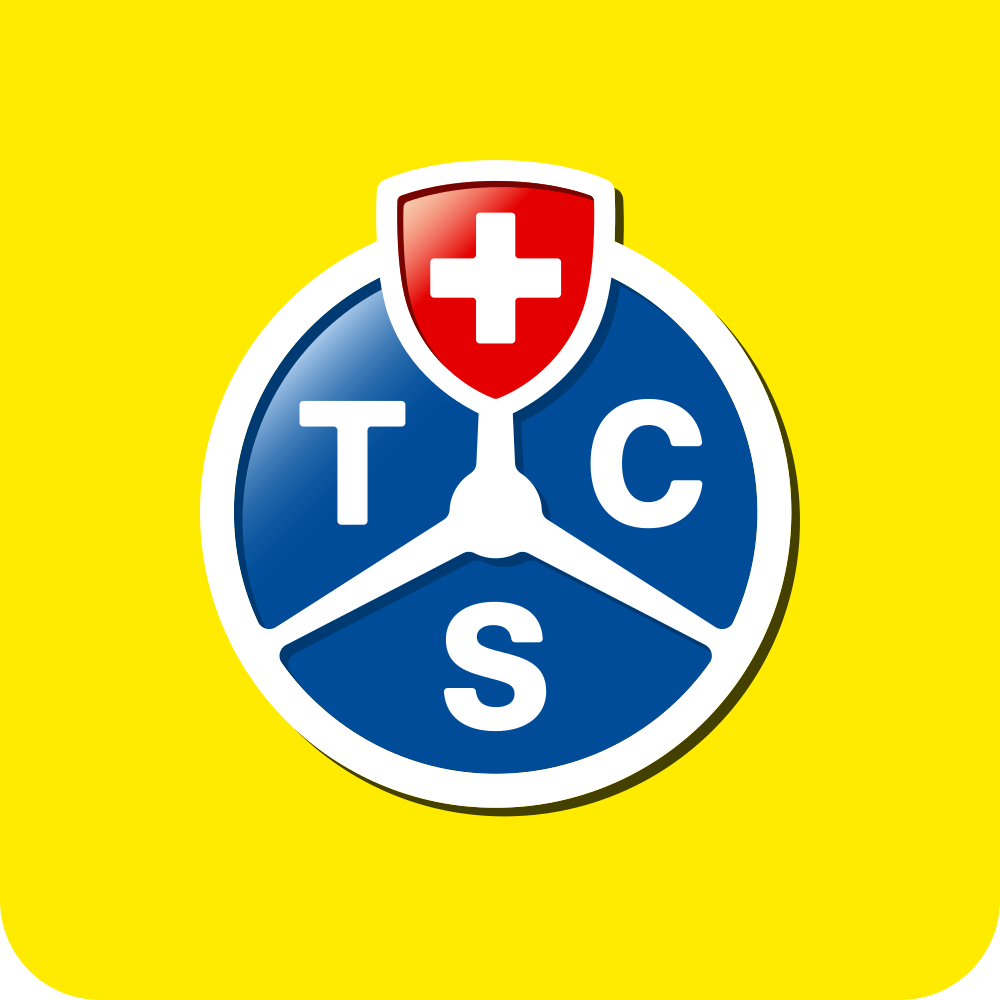Warenfälschung
Rechtsweg
- Ich habe der Vernichtung zugestimmt. Drohen mir seitens IGE oder BAZG noch weitere Massnahmen?
- Ein Anwalt verlangt CHF 900 von mir wegen Markenschutzverletzung. Muss ich das bezahlen?
- Die Markeninhaberin hat eine Zivilklage gegen mich erhoben. Was bedeutet das?
- Die Markeninhaberin hat Strafantrag gegen mich gestellt. Was bedeutet das?
- Kann ich den Onlineshop verklagen, weil er mir gefälschte Ware verkauft hat?
Ich habe der Vernichtung zugestimmt. Drohen mir seitens IGE oder BAZG noch weitere Massnahmen?
Vereinfachtes Verfahren: Die Vernichtung der Ware beendet das vereinfachte Verfahren für den Besteller grundsätzlich. Erweist sich die Vernichtung der Ware im Nachhinein als unbegründet, muss sich der Besteller an die Rechteinhaberin wenden, ausschliesslich sie haftet für den entstandenen Schaden. Hat der Besteller der Vernichtung allerdings schriftlich zugestimmt, verliert er seinen Anspruch auf Schadenersatz.
Ordentliches Verfahren: Im ordentlichen Verfahren kann die Rechteinhaberin namentlich vorsorgliche Massnahmen beim Gericht verlangen.
IGE und BAZG stellen dem Besteller keine Kosten in Rechnung, da hier die Markenrechtsinhaberin beziehungsweise die Designrechtsinhaberin kostenpflichtig sind. Die Verordnung über die Gebühren des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit regelt die Höhe dieser Gebühren in ihrem Gebührentarif. So muss die Rechteinhaberin beispielsweise für die Behandlung von Anträgen auf Hilfeleistung des BAZG zwischen CHF 1 500 und CHF 3 000 und für die Meldung an sie inklusive des Zurückbehaltens verdächtiger Sendungen mindestens CHF 50 bezahlen.
Ein Anwalt verlangt CHF 900 von mir wegen Markenschutzverletzung. Muss ich das bezahlen?
Vereinfachtes Verfahren: Die Rechteinhaberin muss sowohl bei der Vernichtung von einer markenrechtlichen Fälschung wie auch bei einer designrechtlichen Fälschung die Kosten übernehmen. Im per 1. Juli 2025 eingeführten vereinfachten Verfahren sind Schadenersatzansprüche gegen den Besteller sowohl im Markenrecht als auch im Designrecht ausdrücklich ausgeschlossen.
Ordentliches Verfahren: Im ordentlichen Verfahren kann die Marken- beziehungsweise Designrechtsinhaberin nach wie vor Schadenersatz verlangen. Sie muss aber die einzelnen Posten – etwa Vernichtungsgebühren und Anwaltshonorare - detailliert auflisten. Pauschalgebühren oder überhöhte Honorare sind nicht gerichtlich durchsetzbar.
Die Markeninhaberin hat eine Zivilklage gegen mich erhoben. Was bedeutet das?
Anders als das verwaltungsrechtliche Verfahren kann das zivilrechtliche Verfahren auch für den privaten Besteller aufwändig und sehr kostspielig werden.
Die Markeninhaberin hat das ausschliessliche Recht, unter der geschützten Marke Waren ein-, aus- oder durchzuführen. Wie das Bundesgericht bestätigte, kann sie dieses Recht namentlich auch gegen Private geltend machen, welche gefälschte Waren einführen, sofern die Herstellerin der Ware gewerbsmässig handelte. Vor Gericht kann die Markenrechtsinhaberin namentlich die Einziehung und Vernichtung der Ware und Auskunft über deren Herkunft verlangen. Dieselben Möglichkeiten hat die Designrechtsinhaberin.
Die Markenrechtsinhaberin kann aber auch Klagen nach Obligationenrecht (OR) «auf Schadenersatz, Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag einreichen. Auch hier hat die Designrechtsinhaberin dieselben Möglichkeiten.
Die Markeninhaberin hat Strafantrag gegen mich gestellt. Was bedeutet das?
Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gefälschter Markenware zu privaten Zwecken ist nicht strafbar. Dasselbe gilt für gefälschte Designware.
Wer hingegen das Markenrecht vorsätzlich zu gewerblichen Zwecken verletzt, macht sich strafbar, es droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Handelt der Täter gewerbsmässig, verfolgen ihn die Strafverfolgungsbehörden von Amtes wegen. Es droht ihm eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Auch wer das Designrecht vorsätzlich zu gewerblichen Zwecken verletzt, macht sich strafbar, auch hier droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.
Kann ich den Onlineshop verklagen, weil er mir gefälschte Ware verkauft hat?
In der Praxis lohnt es sich selten, privat gegen einen Onlineshop vorzugehen, der gefälschte Waren verkauft hat.
Entschliesst der Käufer sich dennoch dazu, kann er zunächst versuchen, den Kaufpreis vom Onlineshop zurückzuerhalten. Je nach Shop bietet dieser auch eigene Mechanismen an und ermöglicht etwa die Rückerstattung des Kaufpreises oder, sofern es sich um eine Plattform mit mehreren unabhängigen Verkäuferinnen handelt, sperrt sie fehlbare Verkäuferinnen.
Ist keine Lösung über den Shop selbst möglich, kann der Besteller gegen die Verkäuferin insbesondere folgende Massnahmen ergreifen:
- Er kann nach einem allfälligen Schlichtungsverfahren beim zuständigen Gericht eine zivilrechtliche Wandelungsklage einreichen und damit versuchen, den Kauf rückgängig zu machen;
- Er kann den Vertrag nach einem allfälligen Schlichtungsverfahren beim zuständigen Gericht anfechten, da er sich über die Eigenschaft der Ware in einem wesentlichen Irrtum befunden hat und der Vertrag für ihn entsprechend unverbindlich ist;
- Hat die Verkäuferin den Eindruck vermittelt, die Ware sei echt, kann der Besteller Strafanzeige wegen Betrugs erheben.