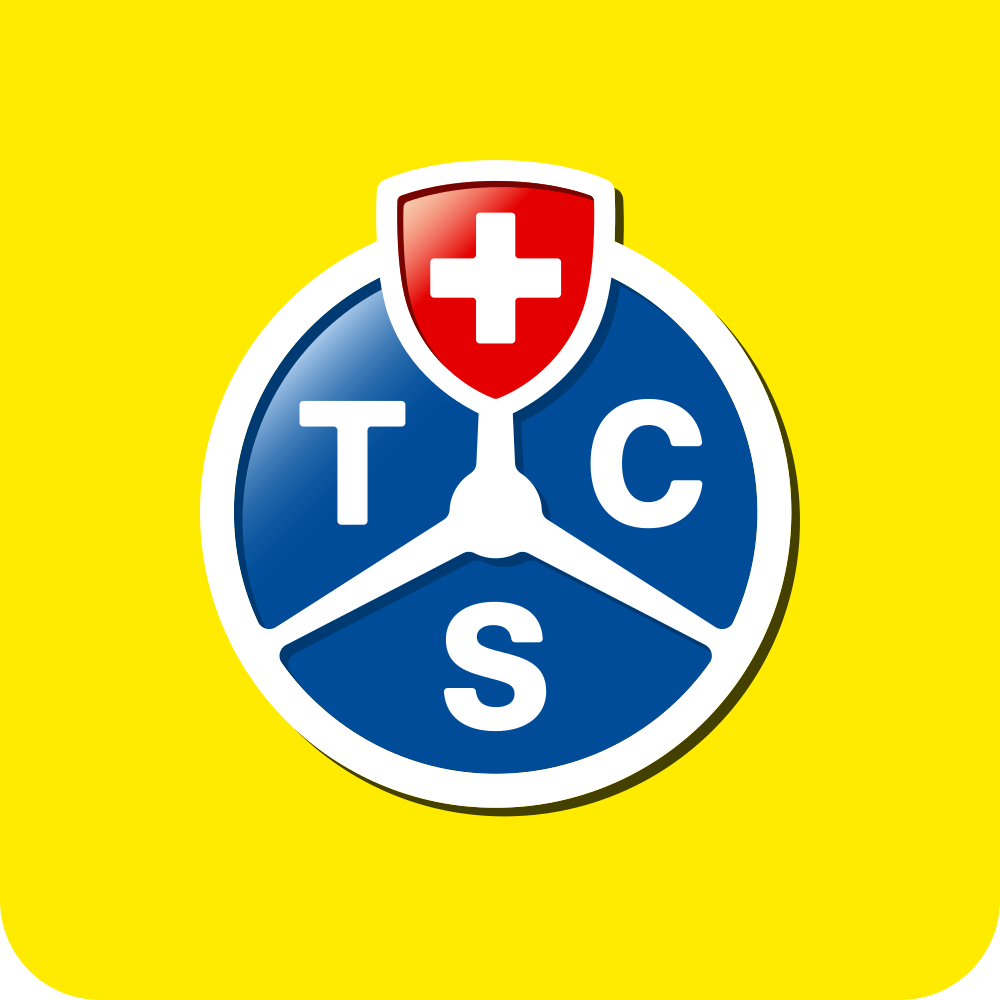Parken
Parkplätze bewirtschaften
- Was ist ein gerichtliches Verbot und wozu dient es?
- Wer darf Parkgebühren verlangen?
- Wer muss Parkgebühren verlangen?
- Ist es zulässig, dass die Bezahlung der Parkgebühr nur per App möglich ist?
- Darf ein Einkaufscenter seine Parkplätze mit Videokameras überwachen?
- Darf eine kantonale oder kommunale Behörde Parkplätze mit Videokameras überwachen?
Was ist ein gerichtliches Verbot und wozu dient es?
Die Eigentümerin eines Parkplatzes kann beim Gericht ein gerichtliches Verbot beantragen um «jede Besitzesstörung» sanktionieren zu können. Das gerichtliche Verbot ist nur bei privat genutzten Parkplätzen zulässig. Hingegen kann sowohl eine Privatperson wie auch ein öffentliches Organ ein solches Verbot beantragen. Sie kann das Verbot mittels dem auf der Site des Bundesamtes für Justiz (BJ) abrufbaren Formular bei dem Gericht des Ortes, an dem der Parkplatz im Grundbuch aufgenommen ist oder aufzunehmen wäre, einreichen. Die Antragstellerin hat «ihr dingliches Recht mit Urkunden zu beweisen und eine bestehende oder drohende Störung glaubhaft zu machen».
Der betreffende Kanton macht das Verbot in seinem Publikationsorgan, meist Amts- oder Kantonsblatt genannt, öffentlich bekannt. Die Grundeigentümerin muss das Verbot zudem an gut sichtbarer Stelle auf dem Grundstück anbringen. Die Verbotstafel muss eine eindeutige Formulierung des Verbots, der Sanktion sowie den Hinweis enthalten, dass es sich um ein vom Gericht erlassenes Verbot handelt.
Wer darf Parkgebühren verlangen?
Während die Nutzung öffentlicher Strassen grundsätzlich gebührenfrei ist, darf die private wie auch die öffentliche Eigentümerin eines Parkplatzes Parkgebühren verlangen, wie das Bundesgericht schreibt: «Das Prinzip der Gebührenfreiheit begründet ein grundsätzliches Verbot für Strassenbenutzungsgebühren. Es verbietet Gebühren für jene Nutzungsarten, welches sich im Rahmen des Gemeingebrauchs bewegen. Für weitergehende Nutzungen im Rahmen des gesteigerten Gemeingebrauchs oder der Sondernutzung ist die Gebührenerhebung hingegen zulässig».
Ein öffentliches Organ wie ein Gemeinderat darf gebührenpflichtige Parkplätze als örtliche Verkehrsmassnahme schaffen. Solange es sich dabei um eine reine Kontrollgebühr handelt, sind die Anforderungen an die formellgesetzliche Grundlage nicht zu hoch anzusetzen. Anders hingegen sieht es bei Parkkarten für das längerdauernde Parkieren auf öffentlichem Grund aus. Dabei handelt es sich nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung um einen so genannten «gesteigerten Gemeingebrauch», für den die Gemeinde zwar Benutzungsgebühren erheben darf, dies aber in einer formellgesetzlichen Grundlage verankert sein muss.
Beabsichtigt eine Gemeinde, neu Gebühren für die Nutzung ihrer öffentlichen Parkplätze zu erheben oder zu erhöhen und verfügt sie in diesem Bereich über eine Marktmacht, muss sie zudem zuvor den Preisüberwacher anhören. Dieser kann eine Empfehlung aussprechen. Folgt die Gemeinde der Empfehlung nicht, muss sie dies begründen.
Wer muss Parkgebühren verlangen?
Aus umweltschutzrechtlichen Gründen kann namentlich die Baubewilligung für eine Anlage davon abhängen, ob die Eigentümerin eine Parkplatzbewirtschaftung mit Parkgebühren eingeplant hat. Je nachdem, innerhalb welcher Anlage ein oder mehrere Parkplätze stehen, untersteht sie der Umweltverträglichkeitsprüfung. Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Anlage Luftverunreinigungen verursacht, erstellt die zuständige Behörde zudem einen Massnahmenplan. Wie das Bundesgericht festhält, obliegt dabei die Wahl der geeigneten Massnahmen den Kantonen, welchen «ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht». (Siehe auch: «Darf die Gemeinde Parkgebühren eines Einkaufszentrums formlos senken?»)
Aus anderen als umweltrechtlichen Gründen darf die zuständige Behörde Privaten jedoch keine Parkgebühren vorschreiben: «Wenn sich ein Konkurrent aus wirtschaftlichen Gründen veranlasst sieht, für seine Parkplätze Gebühren zu erheben, so ist es nicht angängig, alle anderen Konkurrenten zu zwingen, auf ihren Parkplätzen ebenfalls Gebühren zu erheben», so das Bundesgericht.
Ist es zulässig, dass die Bezahlung der Parkgebühr nur per App möglich ist?
In der Schweiz muss jede Person Bargeld annehmen, sofern sie nichts anderes vertraglich geregelt hat. Sowohl ein privates Unternehmen wie auch eine Anbieterin von öffentlichen Leistungen dürfen die Barzahlung jedoch ausschliessen, sofern sie das vorgängig kommunizieren.
Der App-Nutzer sollte sich in jedem Fall vergewissern, dass die App wie auch der Bezahlvorgang funktioniert haben und er das im Streitfall nachweisen kann. Dies gegenüber der Polizei, sofern er eine Parkbusse wegen Nichtbezahlung der Gebühren oder Parkzeitüberschreitung erhält oder gegenüber einer privaten Anbieterin eines Parkplatzes, sofern diese ihm eine Umtriebsentschädigung in Rechnung stellt.
Darf ein Einkaufscenter seine Parkplätze mit Videokameras überwachen?
Eine Videoüberwachung greift in die Privatsphäre der überwachten Personen ein. Überwacht eine Privatperson ihr Parkareal, hat sie sich deswegen an die datenschutzrechtlichen Grundsätze zu halten und muss beispielsweise die betroffenen Personen transparent über die Videoüberwachung informieren.
Eine Privatperson wie ein Einkaufscenter darf ihr Parkareal überwachen, namentlich sofern die Aufnahmen gerechtfertigt sind, etwa aus Sicherheitsgründen. Die Überwachung muss sich auf das Parkareal beschränken und darf nicht weitere Gebiete umfassen. Weiter muss die Privatperson der betroffenen Person auf Anfrage hin namentlich über die Aufbewahrungsdauer Auskunft geben. Schliesslich hat sie auch dafür zu sorgen, dass keine unberechtigten Drittpersonen Zugang zu den Aufnahmen haben. (Siehe auch: «7 Antworten zum neuen Datenschutzgesetz»)
Darf eine kantonale oder kommunale Behörde Parkplätze mit Videokameras überwachen?
Während die Videoüberwachung durch Privatpersonen bundesrechtlich über das Datenschutzgesetz geregelt ist, müssen sich Kantons- und Gemeindeverwaltungen an die jeweiligen kantonalen Datenschutzgesetze halten. Da eine Videoüberwachung das Grundrecht auf Privatsphäre einschränkt, müssen jedoch auch diese kantonalen Regelungen Minimalanforderungen erfüllen.
Die Videoüberwachung muss durch ein formelles Gesetz geregelt und im öffentlichen Interesse sein. Sie muss zudem verhältnismässig sein. Der betreffende Kanton oder die Gemeinde haben so beispielsweise sicherzustellen, dass die Aufnahmen nur so lange existieren, wie sie ihren Zweck erfüllen. Ohne ausserordentliche Vorkommnisse wie beispielsweise das Durchbrechen einer Zugangsschranke sind die Aufnahmen nach einer bestimmten Frist wieder zu löschen.
Damit die Videoüberwachung gesetzeskonform ist, sehen die kantonalen Rechtsgrundlagen regelmässig vor, dass das entsprechend zuständige öffentliche Organ die Datenschutzstelle vor der Installation der Videoüberwachung informiert. Oft ist auch eine Bewilligung, etwa durch die Polizei, notwendig.