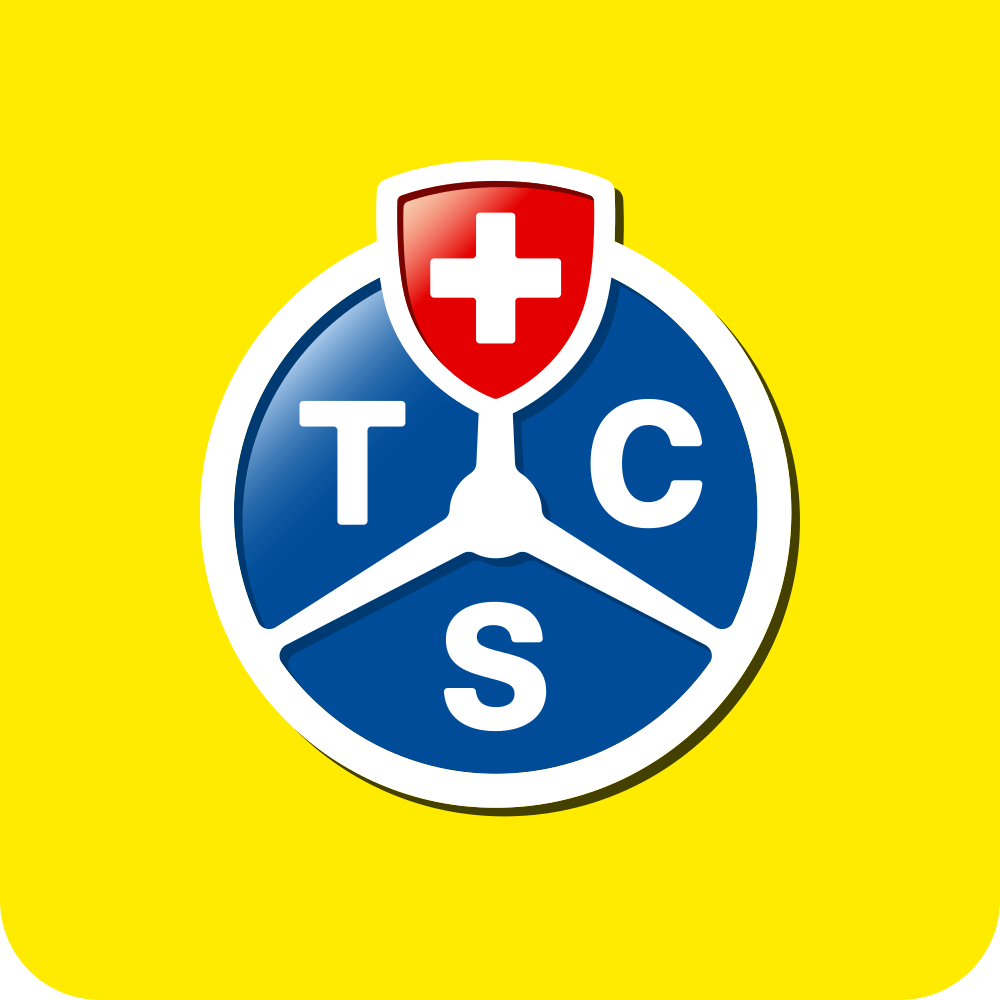Behörden
Darf ein Polizist Halterdaten an eine Sicherheitsfirma weiterleiten?

Auch wenn das Geheimhaltungsinteresse gering ist, unterliegen die im polizeilichen Informationssystem hinterlegten Halterdaten dem Amtsgeheimnis.
Leitet ein Polizist Daten aus dem polizeilichen Halterregister an eine private Drittperson weiter, verletzt er das Amtsgeheimnis. Auch wenn die beschuldigte Person die Weiterleitung der Daten vor Gericht bestreitet, darf dieses von einer Amtsgeheimnisverletzung durch die beschuldigte Person ausgehen, wenn diese die Daten abgerufen hat und ihr Aussageverhalten im Gesamten als widersprüchlich erscheint. Dies hat das Bundesgericht mit Urteil vom 28. Juli 2025 festgehalten. (Siehe auch das zweite Urteil des Bundesgerichts zu der Amtsgeheimnisverletzung des zweiten Polizeibeamten)
Polizist wegen Weiterleitung von Halterdaten verurteilt
Die Staatsanwaltschaft verurteilt einen Polizeibeamten wegen mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses. Sie wirft ihm vor, seinem ehemaligen Arbeitskollegen geschützte Informationen aus den polizeilichen Informationssystemen MACS und INFOCAR weitergeleitet zu haben. Der Polizeibeamte erhebt gegen den Strafbefehl erfolgreich Einsprache beim Bezirksgericht. Gegen den Freispruch wiederum legt die Staatsanwaltschaft Berufung an das Obergericht ein. Dieses verurteilt den Polizeibeamten zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à CHF 220 und einer Verbindungsbusse von CHF 3 000. Der Polizeibeamte gelangt mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht und verlangt einen Freispruch.
Deklaration als «geheim» für Amtsgeheimnis nicht zwingend
Das Amtsgeheimnis verletzt, wer «ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat». Dabei, so das Aargauer Obergericht, ist es «nicht wesentlich, ob die betreffende Tatsache von der zuständigen Behörde als geheim erklärt worden ist». Entscheidend ist lediglich, dass die Tatsache weder offenkundig noch allgemein zugänglich ist und dass der Geheimnisherr ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung hat. Selbst wenn das Interesse an der Geheimhaltung der Halterdaten «als eher gering bezeichnet werden kann», erfüllen die in den polizeilichen Informationssystemen hinterlegten Daten diesen Geheimnisbegriff. Der Polizeibeamte war sich dessen bewusst.
Indizien sprechen gegen Polizeibeamten
Der Polizeibeamte sieht durch den Schuldspruch seine Unschuldsvermutung verletzt. Er bestätigt, dass er die Abfragen im System gestellt hat, bestreitet aber deren Weiterleitung an den ehemaligen Arbeitskollegen.
Unter Verweis auf die Vorinstanz hält das Bundesgericht fest, dass der ehemalige Arbeitskollege unter anderem dem beschuldigten Polizeibeamten eine Liste mit 15 Fahrgestellnummern geschickt hat. Der beschuldigte Polizeibeame hat einen Teil dieser Nummern im Informationssystem abgefragt. Später hat der ehemalige Arbeitskollege die Liste an eine Sicherheitsfirma weitergeleitet. Es liege, so das Bundesgericht, «ausserhalb einer vernünftigen Betrachtungsweise», dass der ehemalige Polizeibeamte die Daten von einer unbekannten Drittperson erhalten habe. Gegen die Unschuld des Polizeibeamten spreche auch, dass der zweitinstanzlich verurteilte Polizeibeamte während der Einvernahme mehrheitlich die Aussage verweigert und Erinnerungslücken geltend gemacht, aber die Weiterleitung der Informationen nicht ausdrücklich bestritten habe.
Das Bundesgericht erachtet die Beweiswürdigung der Vorinstanz als schlüssig und weist die Beschwerde ab. Es auferlegt dem Beschwerdeführer die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 3 000.